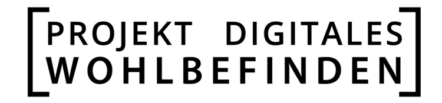Schlechte Software prägt den digitalen Arbeitsalltag vieler Beschäftigter. Wer sich Tag für Tag durch verschachtelte Menüs und kryptische Icons klickt, verliert Motivation und auf Dauer auch Wohlbefinden. Das zeigt eine aktuelle Studie mit Mitarbeitenden aus Deutschland. Gute Usability hingegen gibt Energie zurück und macht Teams produktiver. Dieser Beitrag beschreibt, warum die Qualität unserer Tools entscheidet, ob wir mit Freude arbeiten oder am Bildschirm ausbrennen.

Montagmorgen, 9:15 Uhr: Eva öffnet das CRM-System, das sie für jede Kundenanfrage braucht. Nach einer Fehlermeldung, die sie zweimal wegdrückt, friert der Screen ein. Nach fünf Minuten im Labyrinth aus Menüs, welches für ein IT-Ticket notwendig ist, merkt sie wie der Puls steigt und die Laune sinkt. Was wie ein banales Softwareproblem aussieht, ist Alltag in vielen Büros.
Kleine Frustrationen, die wir oft hinnehmen, weil „das Programm halt so ist“. Doch wer täglich mit schlecht bedienbarer Software arbeitet, merkt irgendwann: dieser Alltag kostet nicht nur Zeit, sondern ist auch ermüdend. Stressig. In manchen Fällen macht es sogar krank. Denn schlecht gestaltete digitale Werkzeuge erschöpfen Menschen.
Was häufig übersehen wird: Die Qualität der digitalen Werkzeuge ist ein entscheidender Faktor für unser psychisches Wohlbefinden am Arbeitsplatz. Wer von der Software eher gebremst als unterstützt wird, verliert Energie, Fokus und Motivation. Eine neue Studie aus Deutschland beleuchtet genau diesen Zusammenhang mit überraschend klaren Ergebnissen.
Digitales Wohlbefinden ist kein Luxus
Wenn von digitalem Wohlbefinden die Rede ist, denken viele zuerst an Bildschirmzeit oder die ständige Erreichbarkeit durch das Smartphone. Doch der Begriff greift weiter. Er beschreibt, wie Technologien unser psychisches und soziales Befinden beeinflussen – positiv wie negativ. Gerade in der Arbeitswelt hängt viel davon ab, wie gut sich digitale Tools in unseren Alltag einfügen. Sind sie intuitiv, schnell und unterstützend, fördern sie Konzentration, Autonomie und produktives Arbeiten. Sind sie hingegen träge, kompliziert oder fehleranfällig, kosten sie uns kognitive Energie – und im schlimmsten Fall auch Motivation und Gesundheit.
Bislang wurde wenig untersucht, welchen Einfluss die → Usability, also die wahrgenommene Gebrauchstauglichkeit von Software, auf psychosoziale Faktoren wie Burnout oder Motivation hat. Genau hier setzt die neue Untersuchung an: Sie nimmt Usability nicht nur als technisches Kriterium ernst, sondern als bedeutsamen Bestandteil des Arbeitsumfelds – vergleichbar mit Zeitdruck oder sozialem Support.
Usability als Belastung und Ressource
Die Studie basiert auf Daten von 589 berufstätigen Personen in Deutschland, die ihre Arbeitsaufgaben hauptsächlich mit digitalen Tools erledigen. Die zentrale Fragestellung: Welche Rolle spielt die wahrgenommene Usability dabei, wie ausgelaugt oder engagiert sich Mitarbeitende fühlen?
Zur Analyse wurde das bewährte Job-Demands-Resources-Modell (→ JDR) genutzt. Dieses unterscheidet zwei Wirkpfade: Erstens den Gesundheitspfad, bei dem hohe Belastungen zu Erschöpfung und Burnout führen, und zweitens den Motivationspfad, bei dem unterstützende Ressourcen zu mehr Engagement und Energie führen. Die Studie nimmt an, dass Usability auf beide Pfade gleichzeitig wirkt, also Ressource und Belastung sein kann.
Konkret zeigt sich: Wer Software als benutzerfreundlich erlebt, nimmt die digitale Arbeitsumgebung als weniger stressig wahr und fühlt sich zugleich besser unterstützt. Schlechte Usability hingegen erhöht die wahrgenommene Beanspruchung am Arbeitsplatz, was zu mehr Stress und Erschöpfung führt. Die Effekte sind statistisch signifikant, Usability ist also kein „Nice-to-have“, sondern ein zentraler Faktor für das emotionale Erleben von Arbeit.
Zur Studie:
Usability of Workplace Software as a Psychosocial Factor: A Structural Equation Model of Work Engagement, Burnout, and Affective Well-Being
von Tim-Can Werning & Andreas Hinderks, 30. Juni 2025
Die Studie zeigt: Je benutzerfreundlicher die digitalen Arbeitsmittel sind, desto engagierter sind Mitarbeiter*innen und desto geringer sind ihre Burn-out-Symptome. Schon ein vergleichsweise kleiner Sprung in der Bedienfreundlichkeit (etwa von „okay“ zu „gut“) geht mit einem messbaren Plus an Arbeitsengagement und einer deutlich geringeren Erschöpfungsbelastung einher. Insgesamt kann das Modell fast die Hälfte (42 %) der Unterschiede im Arbeitsengagement und gut ein Drittel (33 %) für Burn-out erklären – für sozialwissenschaftliche Studien ein guter Wert.
Ein besonders interessanter Aspekt der Studie ist die doppelte Rolle, die Usability spielt. Sie kann je nach Ausprägung in beide Richtungen wirken. Wenn die Bedienbarkeit schlecht ist, wird Usability als zusätzliche Belastung empfunden, ähnlich wie Zeitdruck oder unklare Prozesse. Wenn sie gut ist, wird sie zur Quelle von Energie, Autonomie und Kompetenzempfinden. Für die Praxis bedeutet das: Verbesserungen in der Usability wirken gleich doppelt – sie senken Belastungen und erhöhen gleichzeitig die Motivation.
Gerade in der heutigen Arbeitswelt, in der digitale Tools nahezu jede Tätigkeit durchdringen, ist das ein starkes Argument dafür, technische Gestaltung nicht nur unter Effizienz- oder Sicherheitsaspekten zu betrachten, sondern als Teil der förderlichen Arbeitsgestaltung gegenüber Mitarbeitenden.
Zwischen Burnout und Flow: Software als Wegweiser
Die Ergebnisse der Studie sind auch deshalb so bedeutsam, weil sie zeigen, wie eng Softwarequalität mit psychischen Schlüsselgrößen wie Burnout und Engagement verknüpft ist. Schlechte Usability erhöht nicht nur die wahrgenommene Belastung, sondern auch das Risiko für Burnout. Gute Usability hingegen wirkt entlastend – und das nicht nur kurzfristig, sondern über stabile Zusammenhänge hinweg.
Das Arbeitsengagement (ein Zustand, in dem Menschen sich voller Energie, Hingabe und Konzentration ihrer Tätigkeit widmen) wird stark durch wahrgenommene Usability beeinflusst. Hier spielt vor allem die Rolle als Ressource eine zentrale Rolle: Intuitive Tools geben Kontrolle zurück, ermöglichen schnelle Erfolgserlebnisse und erleichtern die Zusammenarbeit. All das stärkt die psychologischen Grundbedürfnisse nach Autonomie, Kompetenz und Eingebundenheit – zentrale Pfeiler für Motivation und langfristige Zufriedenheit.
Was Unternehmen tun können
Die Schlussfolgerungen aus der Studie sind klar: Wer Software bereitstellt, trifft damit immer auch eine Entscheidung über das Arbeitsklima und die psychische Gesundheit im Unternehmen. Gute Usability senkt die Wahrscheinlichkeit für krankheitsbedingte Ausfälle, verbessert die Performance und stärkt die Bindung an den Arbeitgeber.
Daraus ergeben sich mehrere konkrete Empfehlungen: Organisationen sollten Usability-Checks nicht nur im Rahmen von IT-Projekten, sondern als festen Bestandteil der Gefährdungsbeurteilung etablieren. Außerdem sollten Mitarbeitende regelmäßig die Möglichkeit haben, Rückmeldungen zu geben und an der Weiterentwicklung mitzuwirken. Und auch Schulungen und Trainings spielen eine wichtige Rolle: Oft wird das volle Potenzial vorhandener Tools gar nicht genutzt, weil Kenntnisse fehlen oder der Einstieg nicht intuitiv genug ist.
Besonders wirksam ist partizipatives Design – also die frühzeitige Einbindung von Nutzer*innen in Entwicklungs- und Auswahlprozesse. Wer später mit der Software arbeiten soll, kennt die Anforderungen am besten. Dieser Ansatz verhindert Fehlentwicklungen und erhöht gleichzeitig die Akzeptanz im Team.
Auch Nutzer*innen haben Gestaltungsmacht
Natürlich liegt nicht alles in der Hand von Unternehmen oder Entwickler*innen. Auch Nutzer*innen selbst können Einfluss auf ihr digitales Wohlbefinden nehmen – und zwar auf mehreren Ebenen. Wer sich die Zeit nimmt, Shortcuts zu lernen oder die Oberfläche individuell anzupassen, reduziert alltägliche Reibungsverluste. Der Austausch im Team über funktionierende Workarounds oder sinnvolle Plugins kann ebenso hilfreich sein wie die bewusste Entscheidung für regelmäßige digitale Pausen.
Wichtig ist auch: Beschwerden über schlechte Usability sollten nicht als „Jammern“ abgetan werden. Sie sind oft Ausdruck realer Belastungen – und bieten Hinweise darauf, wo Verbesserungen nötig sind. In vielen Fällen entstehen bereits durch kleine Anpassungen spürbare Entlastungen.
Fazit: Digitale Software gestalten, die uns stärkt
Die vorgestellte Studie macht deutlich: Usability ist kein technisches Detail, sondern ein zentraler Faktor für psychisches Wohlbefinden im digitalen Arbeitskontext. Sie entscheidet darüber, ob wir mit Energie und Freude arbeiten oder frustriert und → gestresst vor dem Bildschirm sitzen.
Wer digitale Werkzeuge gestaltet, hat also auch immer eine Verantwortung dafür, wie motiviert und engagiert Mitarbeitende durch die Interaktion werden. Die gute Nachricht: Investitionen in bessere Usability lohnen sich mehrfach – für die einzelnen Nutzer*innen, für Teams und für Organisationen insgesamt.
In einer Arbeitswelt, die immer digitaler wird, ist es höchste Zeit, Software nicht nur funktional, sondern auch menschlich zu denken.
Das Projekt Digitales Wohlbefinden

Im Projekt [ Digitales Wohlbefinden ] verfolgen wir das Ziel, die psychische Gesundheit und die Arbeitszufriedenheit von Mitarbeitenden durch Verbesserungen in der digitalen Arbeitsumgebung nachhaltig zu stärken.
Im Mittelpunkt steht der bewusste Umgang mit digitalen Technologien und die Gestaltung nutzerfreundlicher Softwarelösungen, die den Arbeitsalltag erleichtern und nicht zusätzlich belasten.