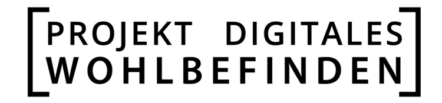Im Kontext der industriellen Transformation werden Unternehmen zunehmend digitaler. Beschäftigte interagieren bei der Bearbeitung vieler Aufgaben bereits mit verschiedenen Programmen, welche die Arbeit im Idealfall unterstützen. Teilweise sind die Anwendungen jedoch sehr komplex und schwer zu lernen, was die Beschäftigten sogar an der Erledigung ihrer Aufgaben hindern kann. Eine erfolgreiche menschzentrierte Digitalisierung kann daher nur unter Berücksichtigung menschzentrierter Gestaltungsprozesse stattfinden.
Die Arbeitswelt befindet sich in einem herausfordernden Transformationsprozess. Für immer mehr betriebliche Abläufe werden digitale Lösungen geschaffen, um diese effizienter zu gestalten. Durch die Digitalisierung verändern sich Arbeitsplätze teils radikal und die Komplexität betrieblicher Software nimmt rapide zu. Klar ist, dass sich fast jedes Berufsbild durch den Einsatz von Technologie verändert. Es liegt in der Verantwortung von Führungskräften und Personaler:innen, dass die betriebliche Digitalisierung zum Erfolg wird.
In Digitalisierungsvorhaben werden sowohl bekannte als auch neue digitale Technologien in internen und externen Abläufen eingesetzt, welche die Arbeitsweise der Beschäftigten revolutionieren (sollten). Dennoch können konkrete Pläne zur Digitalisierung in Unternehmen leicht scheitern. Die Boston Consulting Group hat mehr als 800 dieser Transformationsprozesse untersucht und kommt zu dem Ergebnis, dass lediglich 30% zu ihrem angestrebten Ziel führen. Doch wie kann sichergestellt werden, dass Digitalisierung erfolgreich umgesetzt wird?
Erfolgreiche Digitalisierung
In der Praxis passiert es häufig, dass bestimmte Abläufe digitalisiert werden, ohne die eigentlichen Anforderungen zu berücksichtigen. Daher ist es wichtig festzuhalten, dass Digitalisierung kein Selbstzweck ist, nur um sagen zu können: „Jetzt ist es digital!“. Die Transformation von Prozessen muss immer ein klar definiertes Ziel haben.
Häufig wird sich bereits sehr früh im Digitalisierungsprozess auf die Ausgestaltung einer konkreten Lösung fokussiert. Die Funktionalität betrieblicher Fachanwendungen wird in den Mittelpunkt gestellt, während die Benutzerfreundlichkeit oft unbeachtet bleibt. Daher entsteht das Risiko, dass das Produkt eine mangelhafte Gebrauchstauglichkeit (engl.: Usability) besitzt. Unter Usability versteht man das Ausmaß, in dem ein interaktives System von Menschen benutzt werden kann, um Ziele effektiv, effizient und zufriedenstellend zu erreichen. Ob ein neues System durch die Beschäftigten als unterstützend und nützlich bewertet wird, hängt maßgeblich von der Usability ab und beeinflusst die Akzeptanz der Digitalisierungsmaßnahme stark. Je komplexer betriebliche Anwendungen sind, desto wichtiger ist hier die optimale Gebrauchstauglichkeit. Bleibt diese unbeachtet, riskieren Stakeholder bei Einführung des Systems eine langfristige Reduktion der Produktivität. Um digitale Produkte erfolgreich zu etablieren, sollten diese daher spezifischen Anforderungen im Sinne der Gebrauchstauglichkeit gerecht werden.
Ein Schlüssel zu erfolgreicher Digitalisierung von betrieblichen Prozessen ist die Verwendung von verständlicher und einfacher Software, welche die Anforderungen der Beschäftigten erfüllt.
Human-centered design
Um Digitalisierung in Unternehmen und Behörden kompetent umzusetzen, stellt gute Usability der Anwendungen also ein Erfolgskriterium dar. Als Orientierung kann hier die ISO-Norm 9241-210 dienen, die den Prozess der menschzentrierten Gestaltung definiert. Diese internationale Norm beschreibt, wie ein interaktives System nutzerzentriert gestaltet und dessen Usability systematisch verbessert werden kann. In mehreren Phasen werden die Nutzungsanforderungen des Produkts identifiziert, Gestaltungslösungen entwickelt und im Anschluss mit echten Nutzer*innen evaluiert. Der Prozess zeichnet sich durch einen iterativen Ansatz aus, in dem die Schritte so lange wiederholt werden, bis die Nutzungsanforderungen ausreichend erfüllt sind.
Von Stakeholdern wird systematisch unterschätzt, wie wichtig eine gute Usability für die erfolgreiche Digitalisierung ist. Wie benutzerfreundlich eine Software am Arbeitsplatz ist, spielt eine bedeutende Rolle für die Effizienz, Effektivität und das Wohlbefinden der Beschäftigten – und damit auch für den Erfolg des Unternehmens im Gesamten. Wird ein schlechtes Programm eingeführt, so werden die Abläufe eher verlangsamt und Beschäftigte lehnen es mit höherer Wahrscheinlichkeit ab. Die Verwendung im Arbeitsalltag hat außerdem Einfluss auf das Wohlbefinden der Mitarbeitenden. Nicht umsonst ist die psychische Belastung aufgrund mangelhafter Software ein Teil der Gefährdungsbeurteilung Psyche. Eine sorgfältig optimierte Usability der betrieblichen Software steigert im Gegensatz dazu sowohl die Produktivität als auch die Zufriedenheit der Nutzenden.
Usability als Erfolgskriterium der Digitalisierung
Die Erwartungen an betriebliche Software entwickeln sich synchron zum privaten Bereich – hier sind Nutzer*innen von Anbietern wie Google oder Apple eine hohe Benutzerfreundlichkeit gewohnt. Deren jahrelange Optimierung der gesamten Benutzerfreundlichkeit hat zu digitalen Produkten geführt, die nahezu jeder Mensch unkompliziert bedienen kann. Eben diese einfache und verständliche Bedienung erwarten Benutzer*innen auch bei professioneller Software und sind heutzutage weniger bereit, schlechte Usability in Arbeitssystemen hinzunehmen. In der Konsequenz bedeutet dies, dass Unternehmen und Behörden das Thema nicht weiter vernachlässigen können.
Während große Unternehmen häufig eigene Software entwickeln, nutzen gerade kleinere und mittelständische Betriebe externe Produkte. Bei der Frage, wer die Verantwortung für die Initiierung der menschzentrierten Gestaltung zur erfolgreichen Umsetzung von Digitalisierung trägt, sind sowohl die Personalabteilung, das Management als auch Betriebsräte gefragt. Natürlich führen die Gremien die Untersuchung nicht selbst durch, vielmehr geht von ihnen der Impuls aus, betriebliche Softwareprogramme auf Gebrauchstauglichkeit untersuchen zu lassen. Dafür kommen entweder interne User Experience Professionals oder externe Agenturen in Frage. Außerdem sollten Expert*innen für menschzentrierte Gestaltung von betrieblicher Software bereits in den Entwicklungsprozess einbezogen werden, um den Qualitätsstandards in Zukunft bereits bei Einführung gerecht zu werden.
Digitalisierung ist eine Herausforderung für viele Branchen. Dieser Transformationsprozess kann nur dann erfolgreich umgesetzt werden, wenn die Softwarelösungen eine hohe Usability aufweisen. Nur so kann die Einführung von neuen digitalen Systemen nachhaltig gelingen und einen echten Mehrwert bieten.