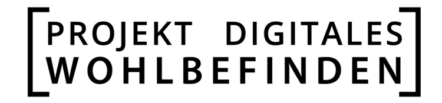Technostress
Was ist Technostress?
Technostress beschreibt die psychische Belastung, die durch den Umgang mit digitalen Technologien entsteht – vor allem am Arbeitsplatz. Der Begriff wurde bereits in den 1980er Jahren geprägt (Brod, 1984), gewinnt aber im Zuge der Digitalisierung zunehmend an Bedeutung. Technostress kann auftreten, wenn Menschen sich überfordert fühlen, zu wenig Kontrolle über neue Systeme haben oder digitale Tools schlecht gestaltet sind.
Im Kern geht es um eine Stressreaktion auf digitale Anforderungen: etwa durch komplexe Software, ständige Erreichbarkeit oder fehlende Unterstützung im Umgang mit neuen Technologien.
Die fünf Aspekte von Technostress
Mitarbeitende haben bei der Techno-Überforderung das Gefühl, zu viel, zu schnell und unter ständigem Druck mit digitalen Tools arbeiten zu müssen.
Beispielweise kann das passieren, wenn eine neue Projektmanagement-Software wird eingeführt, während gleichzeitig noch drei andere Systeme verwendet werden müssen – ohne klare Abgrenzung oder Priorisierung. Techno-Overload führt zu mentaler Ermüdung, ineffizientem Arbeiten und kann langfristig zur Reduktion von Arbeitsengagement führen.
Die Grenzen zwischen Beruf und Privatleben verschwimmen, weil digitale Geräte und Tools jederzeit Zugriff auf Arbeitsinhalte ermöglichen.
Mitarbeitende beantworten E-Mails am Abend oder am Wochenende über das Diensthandy, weil dies „erwartet“ wird. Techno-Invasion verhindert Erholung und trägt zur sogenannten „Entgrenzung der Arbeit“ bei – ein Risikofaktor für Burnout und Schlafstörungen.
Die eingesetzte Technologie ist schwer verständlich, schlecht erklärt oder benötigt umfangreiche Einarbeitung.
Wenn ein neues ERP-System zum Beispiel eine komplexe Schulungen erfordert, es aber an Anleitung oder verständlicher Benutzeroberfläche fehlt, kann es zu hoher wahrgenommener Techno-Komplexität kommen. Hohe wahrgenommene Komplexität senkt die digitale Selbstwirksamkeit und erhöht die Wahrscheinlichkeit für Frustration und Rückzug.
Ständige Updates, wechselnde Systeme und fehlende Stabilität erzeugen zu Unsicherheit und Kontrollverlust, was zu Sorgen führt.
Wenn zum Beispiel ein vertrautes Tool kurzfristig durch eine neue Software ersetzt wird und die neuen Prozesse unklar sind, kann es zu digitaler Verunsicherung kommen. Technologische Unsicherheit untergräbt das Sicherheitsgefühl und erschwert die Arbeitsplanung. Sie ist eng mit niedrigem Vertrauen und erhöhter Ablehnung gegenüber neuen Technologien verbunden (Salanova et al., 2013).
Technologien können auch als Bedrohung für den eigenen Arbeitsplatz wahrgenommen werden, etwa durch Automatisierung oder KI.
Wenn etwa eine KI-basierte Software Aufgaben übernimmt, die vorher manuell erledigt wurden, sorgen sich Beschäftigte teilweise um ihre Relevanz und Zukunft. Techno-Insecurity ist besonders in Branchen mit hoher Automatisierung relevant. Studien zeigen, dass solche Sorgen zu Demotivation, Rückzug und Burnout beitragen können (Mahapatra & Pati, 2018).
Was sind die Auswirkungen von Technostress?
Technostress kann sich auf vielfältige Weise negativ auf das Wohlbefinden von Mitarbeitenden auswirken – psychisch, körperlich und organisatorisch. Besonders häufig sind psychische Reaktionen wie Angst, Erschöpfung, innere Distanz zur Arbeit oder der Verlust von Effizienz zu beobachten.
Eine der zentralen Auswirkungen ist die Zunahme von Angst und Unsicherheit im Umgang mit digitalen Systemen. Studien zeigen, dass insbesondere neue oder komplexe Technologien bei vielen Beschäftigten Sorgen auslösen, nicht mehr mithalten zu können, Fehler zu machen oder durch Inkompetenz aufzufallen (Tarafdar et al., 2015). Diese Form der Unsicherheit wird durch ständig wechselnde Tools oder unklare IT-Strategien zusätzlich verstärkt. In manchen Fällen reicht die Angst sogar so weit, dass Mitarbeitende befürchten, durch technologische Entwicklungen ersetzt zu werden – insbesondere dort, wo KI-basierte Systeme zum Einsatz kommen.
Auch die psychische Ermüdung ist eine häufige Folge. Wer tagtäglich mit E-Mail-Flut, Chat-Nachrichten, Videokonferenzen und spezialisierten Tools jonglieren muss, fühlt sich schnell überlastet. Die ständige Informationsverarbeitung, unterbrochen durch digitale Ablenkungen, reduziert nachweislich die Konzentrationsfähigkeit und beeinträchtigt die mentale Erholung (Kushlev & Dunn, 2015). In Umfragen berichten Betroffene von einem dauerhaften Gefühl der Anspannung und Erschöpfung, das bis in den Feierabend anhält.
Ein weiteres Warnsignal ist die Entwicklung einer skeptischen oder distanzierten Haltung gegenüber digitalen Technologien. Forschende sprechen hier von einem Zustand, der an frühe Phasen des Burnout erinnert (Mahapatra & Pati, 2018). Wer regelmäßig negative Erfahrungen mit schlecht gestalteten oder überfordernden Systemen macht, zieht sich innerlich zurück. Die Motivation sinkt, neue Tools auszuprobieren, die Akzeptanz für digitale Veränderungen schwindet. Solche Reaktionen wirken sich nicht nur auf das persönliche Wohlbefinden aus, sondern können ganze Digitalisierungsinitiativen gefährden.
Mit zunehmendem Technostress lässt auch die Effizienz in der Arbeit nach. Betroffene berichten häufiger von dem Gefühl, weniger leisten zu können, langsamer zu arbeiten oder die Kontrolle über ihre Aufgaben zu verlieren. Eine Untersuchung von La Torre et al. (2020) zeigt, dass Technostress mit einem signifikanten Rückgang des Arbeitsengagements verbunden ist. Das heißt: Wer digital überfordert ist, bringt sich weniger aktiv ein, vermeidet neue Aufgaben und empfindet die eigene Produktivität als eingeschränkt. Langfristig leidet darunter nicht nur die Einzelleistung, sondern auch die Zusammenarbeit im Team.
Doch nicht nur die Psyche ist betroffen – auch körperliche Symptome treten häufig auf. Verspannungen im Nacken, Kopf- oder Augenschmerzen, Schlafprobleme oder eine generelle körperliche Unruhe werden regelmäßig in Verbindung mit digitalen Stressfaktoren genannt (Baltaci & Gokcay, 2016). Besonders problematisch: Viele dieser Symptome treten schleichend auf und werden erst spät als Folgen digitaler Überlastung erkannt. Oft verstärken sie sich wechselseitig mit den psychischen Beschwerden, was zu chronischer Erschöpfung oder psychosomatischen Erkrankungen führen kann.
Was hilft gegen Technostress?
Die gute Nachricht: Technostress ist kein unausweichliches Nebenprodukt der Digitalisierung – er lässt sich gezielt reduzieren. Entscheidend ist dabei ein ganzheitlicher Ansatz, der sowohl die individuellen Ressourcen, die Organisation als auch die technischen Systeme berücksichtigt.
So lässt sich digitales Wohlbefinden nachhaltig fördern.
Individuelle Ebene: Resilienz stärken und Kompetenzen aufbauen
Auf persönlicher Ebene steht die Stärkung der psychische Widerstandskraft (Resilienz) im Fokus – also der Fähigkeit, mit Stress und digitalen Herausforderungen konstruktiv umzugehen. Menschen mit hoher digitaler Selbstwirksamkeit und Digitalkompetenz empfinden neue Technologien seltener als belastend.
Daher sind Schulungen und Trainings zentral, die technisches Wissen vermitteln, Selbstvertrauen fördern und den sicheren Umgang mit digitalen Tools erleichtern (Salanova et al., 2014).
Zur Förderung von digitalem Wohlbefinden helfen außerdem bewährte Maßnahmen zur Stressbewältigung, darunter:
Achtsamkeitstrainings und digitale Pausen
Selbstmanagement-Methoden für den digitalen Arbeitsalltag
Aufbau gesunder Routinen im Umgang mit E-Mail, Chat & Co.
Diese Maßnahmen stärken die Resilienz – ein Schlüsselfaktor im gesunden Umgang mit Technostress.
Organisationale Ebene: Strukturen für Wohlbefinden schaffen
Auch Unternehmen tragen eine zentrale Rolle für den Umgang mit Technostress. Eine der wichtigsten Maßnahmen ist es, Mitarbeitende frühzeitig und aktiv in technologische Veränderungen einzubinden. Wer sich gehört und mitgenommen fühlt, zeigt weniger Widerstand – und bleibt gesünder (Lauer, 2019).
Weitere wirkungsvolle Hebel:
Klare Regeln zur digitalen Erreichbarkeit (z. B. Ruhezeiten, E-Mail-Nutzung)
IT-Support und leicht zugängliche Schulungsangebote
Gelebte Führungskultur, die Rückmeldung zulässt und soziale Unterstützung bietet
Organisationen, die solche Strukturen schaffen, erhöhen nicht nur die digitale Resilienz ihrer Mitarbeitenden, sondern fördern auch Innovation und Akzeptanz neuer Technologien – wichtige Pfeiler für nachhaltiges digitales Wohlbefinden.
Technische Ebene: Stressarme digitale Systeme gestalten
Viele digitale Belastungen entstehen durch schlecht gestaltete Software oder komplexe Systeme. Hier ist Human-Centered Design gefragt: also Technologien, die sich an den Bedürfnissen, Fähigkeiten und Erwartungen der Nutzer*innen orientieren (Kadir & Broberg, 2021).
Konkret heißt das:
Einfache, verständliche Bedienoberflächen
Konsistente Nutzerführung ohne Medienbrüche
Systemkompatibilität und stabile Funktionalität
Solche nutzerfreundlichen Lösungen reduzieren Technostress deutlich – und fördern gleichzeitig Akzeptanz, Effizienz und Motivation. Ein gutes Nutzererlebnis wird damit zum Schlüsselfaktor für digitales Wohlbefinden.