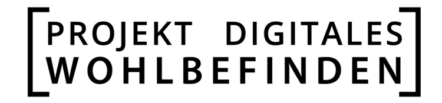Wissen zu digitalem Wohlbefinden
Was ist digitales Wohlbefinden?
Bei digitalem Wohlbefinden handelt es sich um ein relativ junges Konzept, das sich mit dem Einfluss der Digitalisierung auf das menschliche Wohlbefinden beschäftigt. Der Begriff Digitales Wohlbefinden (engl. digital wellbeing) beschreibt grob gesagt, wie digitale Technologien das menschliche Wohlbefinden beeinflussen – positiv wie negativ. Es geht um einen bewussten, reflektierten Umgang mit digitalen Medien, der unsere Lebensqualität fördert.
Digitale Medien sind heute allgegenwärtig, wodurch sich Chancen (z. B. soziale Vernetzung, Zugang zu Wissen) und Risiken (z. B. Stress, Ablenkung) für unser Wohlbefinden ergeben. Seit etwa 2018 hat der Begriff an Popularität gewonnen, insbesondere durch Apps großer Tech-Konzerne (z. B. Apples Screen Time oder Googles Digital Wellbeing) zur Messung und Begrenzung der Bildschirmzeit.
Wohlbefinden selbst wird in der Psychologie oft in hedonisches (subjektives Glück) und eudaimonisches Wohlbefinden (Sinn und Selbstverwirklichung) unterteilt. Digitales Wohlbefinden knüpft an diese Konzepte an, indem betrachtet wird, wie digitale Gewohnheiten sowohl kurzfristige Zufriedenheit (Spaß vs. Stress) als auch langfristige Lebensziele und Bedürfnisse beeinflussen. Entsprechend betonen einige Ansätze digitalen Wohlbefindens den normativen Aspekt: die Kompetenz des Individuums, die eigene Technologienutzung mit persönlichen Werten und Zielen in Einklang zu bringen. Andere stellen die Balance von Vor- und Nachteilen der Technologienutzung in den Vordergrund. Eine häufig zitierte Definition beschreibt digitales Wohlbefinden als die „subjektive individuelle Erfahrung eines optimalen Gleichgewichts zwischen den Nutzen und den Nachteilen, die aus digitaler Konnektivität entstehen“.
Insgesamt herrscht Einigkeit darüber, dass die Auswirkungen digitaler Technologien auf das Wohlbefinden vielschichtig sind. Neuere Forschung berücksichtigt neben einer generellen Nutzungsdauer auch die hohe Komplexität von Technologien: Nicht nur wie viel, sondern wie und warum man digitale Medien nutzt, spielt scheinbar eine wichtige Rolle. Faktoren wie Nutzungsmotivation, Inhaltsart, Nutzungskontext, Software-Gestaltung und individuelle Unterschiede moderieren den Einfluss auf das Wohlbefinden erheblich. Das erschwert eindeutige Aussagen. Große Datenauswertungen deuten zumindest darauf hin, dass die durchschnittlichen direkten Effekte von digitaler Nutzung auf das Wohlbefinden moderat sind – es kommt aber stark auf den Einzelfall an. In den folgenden Abschnitten beleuchten wir verschiedene Facetten dieses Diskurses aus psychologischer, sozialer und technologischer Perspektive.
Wie beeinflussen Technologien unser psychisches Wohlbefinden?
Digitale Technologien können sowohl positive als auch negative Auswirkungen auf unser Wohlbefinden haben. Sie ermöglichen Kommunikation, Information und Unterhaltung, können aber auch zu Stress, Überforderung und sozialer Isolation führen. Der ständige Zugang zu Informationen und die Erwartung permanenter Erreichbarkeit können psychischen Druck erzeugen.
Die Interaktion mit digitalen Technologien beeinflusst unser Leben in unterschiedlichen Bereichen und kann aus verschiedenen Perspektiven betrachtet werden: der psychologischen, der sozialen und der technischen.
Aus psychologischer Perspektive wird untersucht, wie digitale Medien das emotionale, kognitive und motivationale Erleben beeinflussen. Neben positiven Effekten wie Zugänglichkeit von Informationen, sozialer Unterstützung und Unterhaltung rücken vermehrt auch Belastungsfaktoren in den Fokus: etwa ständige Erreichbarkeit, Aufmerksamkeitsfragmentierung, exzessive Bildschirmzeiten, sozialer Vergleich auf Plattformen oder technikinduzierter Stress („Technostress“).
Auch auf sozialer Ebene wirken digitale Technologien ambivalent auf unser digitales Wohlbefinden. Einerseits fördern sie Verbindung, Teilhabe und neue Formen der Gemeinschaft, insbesondere über räumliche Distanzen hinweg. Andererseits können sie soziale Isolation verstärken, Beziehungen oberflächlicher werden lassen und durch algorithmisch kuratierte Inhalte Konflikte oder gesellschaftliche Polarisierung begünstigen.
Technologisch betrachtet ist entscheidend, dass die Wirkungen digitaler Medien nicht bloß von ihrer bloßen Existenz, sondern von der konkreten Software-Gestaltung abhängen. Interface-Design, Benachrichtigungslogiken, Empfehlungsalgorithmen und Nutzungsmetriken beeinflussen unser Verhalten. Der zunehmende Einsatz verhaltenspsychologischer Prinzipien im App- und Plattformdesign wirft dabei auch ethische Fragen auf: Inwieweit fördern oder behindern technische Systeme das Wohlbefinden ihrer Nutzer*innen? Welche Verantwortung tragen Entwickler*innen und Unternehmen in Bezug auf die psychosozialen Folgen ihrer Produkte?
Soziale Medien und psychisches Wohlbefinden
Die Rolle von digitalen Technologien für die psychische Gesundheit wird intensiv diskutiert und ist im Bereich von digitalem Wohlbefinden mit am besten untersucht. Grade soziale Medien wie Instagram oder TikTok versprechen positive Angebote wie soziale Interaktion oder Selbstdarstellung, jedoch wird die Nutzung in wissenschaftlichen Studien auch mit Problemen wie Depression oder niedrigem Selbstwertgefühl in Verbindung gebracht. Eine aktuelle Überblicks-Studie berichtet Zusammenhänge zwischen der Dauer der Social-Media-Nutzung und höheren Depressionen, Angstsymptomen und Schlafstörungen (Ahmed et al., 2024).
Wichtig zu betonen ist die Heterogenität der Befunde: Nicht jede*r reagiert gleich. Interindividuelle Faktoren wie Persönlichkeit, Alter oder psychische Vorbelastungen moderieren die Effekte. So neigen Personen mit geringem Selbstwert oder Jugendliche in sensiblen Entwicklungsphasen stärker dazu, sich von negativen Kommentaren oder Vergleichsdruck beeinträchtigen zu lassen, während resiliente Individuen die gleichen Inputs besser wegstecken.
Insgesamt gilt: Die Art der Nutzung ist bedeutsam. Aktive Social-Media-Nutzung (z. B. Austausch mit Freunden, kreatives Posten) wirkt tendenziell weniger schädlich verglichen mit passivem Konsum (endloses Scrollen durch Feeds ohne Interaktion). Zudem können soziale Medien auch positive Effekte haben, etwa indem sie für Gruppen einen sozialen Rückhalt bieten oder Zugehörigkeit vermitteln. Diese potenziellen eudaimonischen Nutzen (z. B. Online-Communities als Unterstützung bei marginalisierten Gruppen, seltenen Krankheiten oder auch Nischenhobbys) stehen im Forschungsdiskurs den Risiken gegenüber, was eine ausgewogene Betrachtung erfordert.
Ständige Erreichbarkeit, Stress und kognitive Überlastung
Moderne digitale Technologien (allen voran das Smartphone) sorgen dafür, dass wir nahezu immer und überall erreichbar sind und mit einer Flut an Informationen konfrontiert werden. Psychologisch kann dies zu anhaltendem Stress beitragen, weil wir nie richtig „abschalten“ können. Das kann zu sogenanntem Technostress führen. Damit ist Stress gemeint, den Nutzer infolge der Nutzung von IKT (Informations- und Kommunikationstechnik) erleben.
Konstante Unterbrechungen durch E-Mails, Chats oder Push-Benachrichtigungen fragmentieren die Aufmerksamkeit und erschweren es, zur Ruhe zu kommen. Dies beeinträchtigt die Konzentrationsfähigkeit und kann Gefühle der Überforderung auslösen, wenn die Informationsflut die Verarbeitungskapazität übersteigt. Viele Menschen verspüren Druck, auf Nachrichten umgehend zu reagieren, sei es aus sozialer Erwartung oder beruflicher Verpflichtung. Diese „Always-on“-Mentalität kann langfristig zu Erschöpfung, Schlafstörungen (durch abendliche Bildschirmnutzung und gedankliches „Nicht-Abschalten-Können“) und reduzierter Leistungsfähigkeit führen, was wiederum das digitale Wohlbefinden beeinträchtigt.
Designmerkmale und Nutzererfahrung
Die Gestaltung der User Experience (damit sind die Wahrnehmungen und Reaktionen einer Person gemeint, die sich vor, während und nach der Nutzung eines Produktes ergeben) spielt eine zentrale Rolle für das digitale Wohlbefinden von Nutzer*innen. Sie entscheidet maßgeblich darüber, wie intuitiv, kontrollierbar und belastend oder entlastend eine digitale Anwendung im Alltag erlebt wird. Eine gute UX orientiert sich einerseits an Effizienz und Benutzerfreundlichkeit, berücksichtigt aber auch psychosoziale Aspekte wie mentale Entlastung, Fokusförderung oder bewusste Pausen. Prinzipien wie Positive Technology oder ethisches UX-Design verfolgen das Ziel, digitale Produkte so zu gestalten, dass sie nicht überfordern, süchtig machen oder permanent unterbrechen, sondern im Einklang mit den Bedürfnissen, Grenzen und Aufmerksamkeitsressourcen der Nutzer*innen stehen. Dazu gehören beispielsweise klare Informationsarchitektur, transparente Algorithmen oder zurückhaltende Benachrichtigungen. Eine gute Gestaltung von Software kann somit nicht nur Nutzung erleichtern, sondern auch digitale Selbstregulation fördern – und leistet damit einen aktiven Beitrag zur Förderung von digitalem Wohlbefinden.
Viele Plattformen verwenden „persuasive“ Design-Elemente, um die Nutzungsdauer ihrer Nutzer*innen zu maximieren. Infinite Scroll-Feeds, ständig neue Benachrichtigungen oder Likes als sozialer Reward zielen darauf ab, Nutzer*innen möglichst lange zu binden. Aus Sicht von digitalem Wohlbefinden sind diese Mechanismen sehr problematisch, da sie impulsives, schwer kontrollierbares Nutzungsverhalten fördern. Beispielsweise führt das endlose Scrollen auf Instagram dazu, dass Nutzer*innen mehr Zeit online verbringen als ursprünglich beabsichtigt und nach der initial angenehmen Erfahrung in eine Übersättigung und ein schlechtes Gefühl umschlägt. Das kann die bereits besprochenen negativen psychischen Effekte verstärken.
Ein weiterer Faktor ist die algorithmische Kuratierung von Inhalten. Empfehlungsalgorithmen priorisieren oft Beiträge, die hohe Engagement-Raten versprechen – das sind nicht zwingend die inhaltlich „gesündesten“ für das Wohlbefinden. So kann eine algorithmisch erzeugte Informationsblase entstehen, die entweder einseitige (möglicherweise polarisierende oder verunsichernde) Inhalte liefert oder den Nutzer in immer neuen Stimuli gefangen hält. Ein Beispiel: Die Explore-Seite von Instagram oder TikToks For You Feed spielen passgenau zur Nutzervorliebe optimierte Häppchen aus – was einerseits unterhält, andererseits aber auch endlos weiterführt. Hier sehen Forscher Risiken durch Overload und fehlende Sättigungssignale: Das System gibt kein natürliches „Stopp, genug jetzt“-Feedback, sondern fördert das Weiterschauen/-scrollen.
Digitales Wohlbefinden am Arbeitsplatz, in der Schule und in der Freizeit
Digitales Wohlbefinden am Arbeitsplatz wird maßgeblich durch die Qualität der eingesetzten Technologien und deren Einbettung in Arbeitsprozesse beeinflusst. Schlechte oder schwer bedienbare Business-Software, unfertige Systeme, fehlende Integration zwischen Tools oder ständige Interface-Wechsel führen nicht nur zu Frustration, sondern auch zu kognitiver Belastung und vermeidbarem Zeitverlust. Besonders kritisch wird das, weil die Nutzung solcher Systeme in der Regel notwendig ist und es keine Alternativen gibt. Mangelhafte Gebrauchstauglichkeit (engl. Usability) wird dabei schnell zum Alltagsstressfaktor, insbesondere wenn Supportressourcen knapp sind und Mitarbeitende gezwungen sind, sich ineffizient durch komplexe Prozesse zu arbeiten. Hinzu kommen strukturelle Bedingungen wie unterbrochene Arbeitsabläufe durch ständige Benachrichtigungen, zu wenig digitale Pausen oder die Erwartung ständiger Erreichbarkeit, die die mentale Belastung weiter erhöhen.
Diese digitalen Belastungen wirken im Sinne des Job Demands–Resources (JD-R) Modells als psychologische Anforderungen (Demands), die Energie verbrauchen und bei dauerhafter Exposition zu Stress führen. Wenn diese Anforderungen nicht durch ausreichende Ressourcen (also z.B. gute Softwareergonomie oder Supportangebote) kompensiert werden, erhöht sich das Risiko für negative Folgeerscheinungen. Zu den dokumentierten Auswirkungen zählen Technostress, emotionale Erschöpfung, sinkende Arbeitszufriedenheit und Burnout. In hybriden und digitalen Arbeitsumgebungen, wo die Grenze zwischen Arbeit und Erholung ohnehin verschwimmt, wirken sich solche Belastungen besonders stark auf das psychische Wohlbefinden aus – und können langfristig zu Produktivitätseinbußen, Gesundheitsrisiken und erhöhter Fluktuation führen. Ein systematisches Management digitalen Wohlbefindens durch nutzerzentrierte Softwaregestaltung, unterstützende Angebote der Organisation und technikbezogene Prävention gewinnt daher stark an Relevanz.
Förderung von digitalem Wohlbefinden
Individuelle Fähigkeiten und Anforderungen
Das digitale Wohlbefinden hängt maßgeblich von den persönlichen Fähigkeiten und Anforderungen der Nutzer*innen ab. Digitale Kompetenzen, also die Fähigkeit, digitale Technologien effektiv und gesundheitsförderlich zu nutzen, sind hierbei entscheidend. Ein Mangel an digitalen Kompetenzen kann zu Unsicherheit, Überforderung und letztlich zu Technostress führen.
Die Selbstbestimmungstheorie der Psychologie betont die Bedeutung von Autonomie, Kompetenz und sozialer Eingebundenheit für das Wohlbefinden. Digitale Technologien sollten daher so gestaltet sein, dass sie diese Bedürfnisse unterstützen, beispielsweise durch intuitive Bedienung, transparente Informationen und Möglichkeiten zur sozialen Interaktion.
Gestaltung von Software
Die Gestaltung von Software, insbesondere die User Experience (UX), hat einen direkten Einfluss auf das digitale Wohlbefinden. Eine positive UX berücksichtigt die psychologischen Grundbedürfnisse der Nutzer*innen und vermeidet übermäßige Ablenkungen. Typische UX-Fallen wie unnötige Features, übermäßige Datenauswertung und zu viele Personalisierungsoptionen können zu Stress führen.
Das Prinzip „Always-on“ und die damit verbundene ständige Erreichbarkeit können zu digitaler Reizüberflutung und Konzentrationsproblemen führen. Studien zeigen, dass selbst die bloße Anwesenheit eines Smartphones die kognitive Leistungsfähigkeit beeinträchtigen kann.
Um dem entgegenzuwirken, sollten Softwarelösungen Prinzipien der „Calm Technology“ verfolgen, bei denen Informationen nur dann in den Vordergrund treten, wenn sie wirklich relevant sind. Dies hilft, die Aufmerksamkeit der Nutzer*innen zu schonen und ihre Konzentration zu fördern.
Organisationelle Aspekte
Grade für digitales Wohlbefinden am Arbeitsplatz spielen Organisationen eine zentrale Rolle. Klare Kommunikationsrichtlinien, Schulungen zur digitalen Kompetenz und ein unterstützendes Arbeitsumfeld sind hierbei essenziell.
Im Homeoffice beispielsweise ist die Trennung von Arbeits- und Privatleben oft erschwert. Organisationen sollten daher Maßnahmen ergreifen, um diese Trennung zu unterstützen, etwa durch flexible Arbeitszeiten, klare Erwartungen hinsichtlich der Erreichbarkeit und die Bereitstellung ergonomischer Arbeitsmittel.
Zudem können digitale Menschmodelle (Digital Human Models, DHM) eingesetzt werden, um Arbeitsplätze ergonomisch zu gestalten und so das Wohlbefinden der Mitarbeitenden zu fördern. Diese Modelle ermöglichen die Simulation und Analyse von Arbeitsprozessen und helfen, Belastungen zu identifizieren und zu minimieren.
Das Projekt Digitales Wohlbefinden

Im Projekt [ Digitales Wohlbefinden ] verfolgen wir das Ziel, die psychische Gesundheit und die Arbeitszufriedenheit von Mitarbeitenden durch Verbesserungen in der digitalen Arbeitsumgebung nachhaltig zu stärken.
Im Mittelpunkt steht der bewusste Umgang mit digitalen Technologien und die Gestaltung nutzerfreundlicher Softwarelösungen, die den Arbeitsalltag erleichtern und nicht zusätzlich belasten.